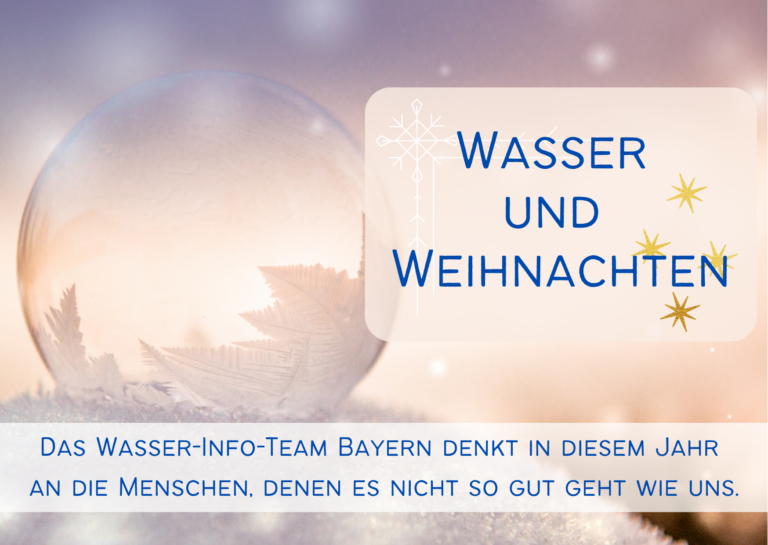Das Interview führte Katrin Zwickl, Wasser-Bloggerin des Wasser-Info-Team Bayern e.V.:
„Hallo liebe Anne und lieber Gunnar, herzlich willkommen zum WIT-Interview! Ich freu mich, dass Ihr Euch Zeit nehmt, um mit mir eine Stunde über das Wasser zu plaudern. Das ist heute das erste Mal, dass wir ein Doppel-Interview haben, und ich bin schon gespannt, was Ihr uns zu erzählen habt.“
Die zwei engagierten Wasser-Experten vom VKU schauen vergnügt und erwartungsvoll in die Kamera. Wie bei jedem von unseren WIT-Interviews treffen auch wir uns heute online in der Videokonferenz.
„Ihr wisst ja: In unserem beliebten Format gibt es immer nur zwei Fragen. Die erste ist die Frage nach dem persönlichen Wasser-Lieblingsthema und die zweite lautet, welche Botschaft der/diejenige unseren Lesern gerne mit auf den Weg geben wollen. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt mit der ersten Frage – wir springen also direkt hinein ins Wasser, wenn man so will. Wer von Euch beiden möchte gerne anfangen?“
Die beiden schauen sich an und lachen.
Gunnar: „Wir machen das heute miteinander und nebeneinander, oder?“
Anne: „Genau – wir spielen Wasserball! Fängst Du an?“
Gunnar: „Oder Du?“ Die beiden sind ganz offensichtlich ein eingespieltes und ausgesprochen fröhliches Team.
Anne: „Wir haben vorhin nochmal Brainstorming gemacht…“, und sie spielt den „Wasserball“ zu ihrem Chef, der ihren Gedanken fließend aufnimmt und weiterführt: „… und da ist uns aufgefallen, dass man das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann.“ Ich stelle fest, das Pingpong zwischen den beiden hat wirklich Flow, um bei den Wasser-Metaphern zu bleiben.
Gunnar: „Ich war früher Schwimmer und bin heute noch gern im Wasser und auf dem Wasser, zum Beispiel beim Paddeln und beim Surfen. Also auch gerne mal auf dem Salzwasser. Und Wasser in Schneeform ist auch ganz hervorragend, zum Beispiel auf Skitouren! Das darf in jedem Aggregatszustand zu mir kommen. Das ist eher die private Seite – beruflich ist mir vor allem der Landschaftswasserhaushalt ein großes Anliegen. Also sprich: Wie halten wir das Wasser draußen in der Fläche, wie sorgen wir dafür, dass es eine gute Qualität hat, dass es wenig schädlichen Einflüssen ausgesetzt ist, so dass wir dann am Ende auch genug für uns alle zur Verfügung haben.“
Anne: „Als wir darüber geredet haben, ist mir aufgefallen, dass ich auch gerne Sport mache, aber das Wasser schau ich mir lieber von außen an. Ich bin eher der Genießer-Typ beim Wasser.“
Gunnar: „Von außen anschauen ist ein gutes Stichwort: Tauchen und Schnorcheln habe ich noch vergessen, das ist auch super!“
Anne lacht: „Ich bleib lieber am Ufer. Ich sitz gerne am Meer, am See oder am Fluss, ich schau gerne die Oberfläche an, ich mag das Plätschern und die Spiegelungen. Ich bin wirklich gerne am Wasser, ich plantsche auch gerne, aber um tiefes Wasser mach ich lieber einen Bogen.“
Gunnar: „Stille Wässer sind tief, oder?“
Anne: „Ich sehe einfach gerne den Grund – ich bin da mehr so der transparente Typ.“
Sie merken, liebe Leserinnen und Leser, dieses Interview ist noch ein bisschen lustiger als alle, die wir Ihnen bisher vorgestellt haben in unserer Reihe!
Anne: „Was mir beim Brainstorming auch noch eingefallen ist: Wenn wir über unsere Wasser-Lieblingsthemen sprechen und unsere persönlichen Erfahrungen mit Wasser in beruflicher und privater Hinsicht, hab ich über meine frühesten Erinnerungen an Wasser nachgedacht. Und natürlich hat jeder Mensch von Beginn seines Lebens an mit Wasser zu tun: Man wird gebadet, man trinkt es, und so weiter. Aber so eine Info, die sich in mir sehr früh verankert hat, ist, dass ein Tropfen Öl 1000 Liter Wasser verunreinigen kann. Oder eben ein Liter Öl eine Million Liter Wasser. Das hat mich geprägt, und deswegen bin ich sehr froh, heute „im Wasser“ arbeiten zu können.“
„Das kann ich gut nachfühlen – ich finde das Thema Wasser auch nach wie vor spannend und arbeite jeden Tag gerne für die und mit der Wasser-Bubble.
Ihr habt ja grade das Thema Landschaftswasserhauhalt angesprochen – darauf würde ich gerne ein bisschen näher eingehen, weil wir das bisher noch gar nicht in unseren Interviews hatten. Könnt Ihr erklären, was man darunter versteht, so dass sich auch „Nicht-Wasserer“ was darunter vorstellen können?“
Gunnar nach kurzem Nachdenken: „Also zunächst hat man ja so die Vorstellung, dass der Regen einfach überall runterkommt und dadurch dann auch überall gleich verteilt ist. Aber das stimmt ja nicht ganz – in den Bergen zum Beispiel regnet es deutlich mehr als zum Beispiel in Franken, wo es insgesamt deutlich trockener ist. Und dann kommt es auch auf die Bodenbeschaffenheit an: Bei Lehmboden schwimmt das Wasser eher oben drauf, bei karstigen Böden ist das Wasser schnell im Untergrund. Und wenn nun der Bagger oder der Traktor darüberfährt, wird der Boden verdichtet. Dann kommt nicht mehr genug Wasser im Untergrund an und es bildet sich nicht mehr genug Grundwasser. Das kann dann zusätzlich zur fehlenden Menge zur Folge haben, dass die Wasserqualität schlechter wird und das Wasser technisch aufbereitet werden muss, bevor es verteilt werden kann. Also: Bis das Wasser aus dem Hahn kommen kann, muss erstmal viel in der Landschaft und im Landschaftswasserhaushalt stimmen, damit wir gutes Wasser haben.“
„Ja, es muss erstmal viel passieren, bis das Wasser bei den Haushalten ankommt. Aber ich glaub, das können sich Leute, die nicht so viel mit der Thematik zu tun haben, trotzdem noch nicht so richtig gut vorstellen. Was muss da genau passieren?“
Anne: „Ich habe mit meiner Tochter mal „Wissen macht Ah!“ geschaut, und da wurde erklärt, wie eine Schwammstadt oder Schwammlandschaft funktioniert. In der Sendung wurde das tatsächlich mit Schwämmen vorgeführt. Sie haben eine Straße mit einem einbetonierten Baum genommen, bei verdichtetem Boden ist es ja ähnlich, und da Wasser drauf geschüttet. Und das Wasser fließt dann einfach weg, in den Straßenabfluss. Dann haben sie Schwämme genommen und um den Baum herumgelegt, und dann wurde das Wasser in den Schwämmen gespeichert und war so für den Baum länger verfügbar. Das ist dann natürlich sehr lokal – beim Landschaftswasserhaushalt müsste man die ganze große Fläche sehen, die dann das Wasser aufnehmen kann, ohne dass es einfach abfließt. Das ist zwar eine sehr vereinfachte Darstellung, aber sie zeigt sehr schön, wie das Wasser entweder abfließt oder eben gespeichert werden kann. Und wenn es trockener wird, und es länger nicht regnet, kann das gespeicherte Wasser dann genutzt werden. Was dabei auch wichtig ist, und was man am Schwamm-Beispiel gut sehen kann: Es dauert immer ein bisschen bis der Schwamm Wasser aufnehmen kann. Das sieht man auch an Zimmerpflanzen sehr gut. Wenn man die eine Weile nicht gegossen hat, und die Erde sehr trocken ist, kann die auch nicht sofort das Wasser aufnehmen. Das heißt, der Boden sollte immer ein bisschen feucht sein, und dafür muss er eine gesunde Bodenstruktur haben. Ihr hattet ja kürzlich ein Interview mit Franz Rösl, der beschreibt, wie ein gesunder Boden aussehen muss, damit er das Wasser gut speichern kann. Das spielt alles zusammen – Boden, Wasser, Entsiegelung – das ist uns wichtig.“
Gunnar: „Es gibt ein schönes Beispiel: Die Leute sollten mal ihre alten Schubladen durchsuchen, auch, wenn zum Beispiel jemand verstirbt und die ganzen alten Dokumente zurückbleiben. Vor vielen Jahren, 50, 60, 80 Jahren, wurden viele Drainagen im Boden verlegt. Vielleicht finden sich dort Skizzen, die damals per Hand angefertigt worden sind, wo diese Drainagen verlaufen. Denn mit diesen Drainagen wird auch Wasser aus der Landschaft rausgeleitet. Das kommt dann in die Bäche und Flüsse und landet am Ende in der Nordsee oder im Schwarzen Meer bevor es im Boden versickern konnte. Ich hab selbst so ein kleines „Citizen Science Project”. Das sind Projekte, bei denen die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden, die nicht selber Wissenschaftler sind, aber ihre Beobachtungen mit Fotos dokumentieren können. Das stellt man dann online und Experten und Expertinnen können die Informationen dann verarbeiten.“
„Sowas gibt´s doch auch vom Landesbund für Vogelschutz, wo die Leute ihre Vogelsichtungen melden können, oder?“
Gunnar: „Genau, so was in der Richtung ist das auch. Und ich kenne eine Wiese in Oberbayern, wo ich seit Jahren vorbeikomme. Vor einigen Jahren wurde der Mutterboden da weggeschoben, es wurden Drainagerohre verlegt und der Boden wurde wieder drübergeschoben. Seitdem ist die Wiese viel trockener und da habe ich angefangen, mit einem Eimer zu messen, wie viel Wasser aus der Drainage rausläuft und hochgerechnet. Aus der Drainage laufen ungefähr 40 Kubikmeter Wasser pro Tag raus. Das sind natürlich nur Schätzwerte, aber seit der Diskussion um den Wassercent wissen wir ja, dass wir in Bayern gerne schätzen, wenn es um das Wasser geht. Und meiner Schätzung zufolge sind 6/7 des Wassers im angrenzenden Bach aus der Drainage von „meiner“ Wiese. Und da stellt sich dann natürlich die Frage: Wie gestalten wir den Landschaftswasserhaushalt? Deshalb zurück zu den Schubladen in alten Häusern und vor allen in alten Bauernhäusern: Dieses ganze Drainagenetz sollte man unbedingt kartieren.“
„Das stelle ich mir als Mammutaufgabe vor…“
Gunnar: „Ja, das wäre eine Mammutaufgabe. Aber eine sehr wichtige, weil sich daraus auch die Frage nach einem Entwässerungsentgelt stellt. Wenn das abgeleitete Wasser etwas kosten würde, hätte jeder Landwirt und auch das Bauwesen ein Interesse daran, dass das Wasser in der Landschaft bleibt.“
Anne: „Bei den Drainagen gibt es seit ein paar Jahren aber auch vermehrt Beispiele, wie das Wasser hieraus weiterverwendet werden könnte. So gibt es einige Pilotprojekte und Betriebe, die daran arbeiten, die Drainagesysteme umzubauen oder das abgeleitete Wasser aufzufangen.“
Gunnar Braun und Anne-Sophie Dörnbrack sind beide ganz in ihrem Element, erklären, erzählen von verschiedenen Projekten, von Hochwasserschutz durch gesunden Boden, Schwammstädten und Schwammregionen, sie erzählen von Positiv-Beispielen wie dem Wasserschutz-Weizen-Projekt der Aktion Grundwasserschutz, von Innovationen im Bereich Landwirtschaft mit Robotik und GPS-Einsatz, von Brachezeiten auf landwirtschaftlichen Äckern und davon, dass sich ein gut gestalteter Landschaftswasserhaushalt langfristig auch finanziell lohnt. Für landwirtschaftliche Betriebe, für Steuerzahler, für Wasserversorger. Je mehr Wasser in der Fläche gehalten werden kann, desto mehr Wasser kann vor Ort verteilt werden und muss nicht über teils weite Strecken transportiert werden. Der Landschaftswasserhaushalt hat Auswirkungen auf allen Ebenen, lerne ich. Und ich lerne, dass eine Stunde viel zu wenig Zeit ist, um mit dem beiden über ihr Herzensthema zu sprechen.
„Das klingt alles wirklich wahnsinnig spannend, und ich bin sicher, unsere Leserschaft hat jetzt eine solide Vorstellung davon, wie wichtig ein gesunder Boden und ein gut funktionierender Landschaftswasserhaushalt ist. Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zur zweiten und damit zur Abschlussfrage des Interviews. Ihr wisst, dass am Ende unserer schönen Wasser-Gespräche immer die Frage nach einer persönlichen Botschaft an unsere Leserinnen und Leser steht. Was möchtet Ihr unserer Community gerne mit auf dem Weg geben?“
Die beiden schauen sich an und lachen: „Oh, da haben wir uns jetzt gar nicht abgestimmt! Darf jeder von uns beiden für sich antworten?“
„Da haben wir keine Regeln.“, antworte ich amüsiert. „Das dürft Ihr machen, wie Ihr möchtet.“
Anne zu Gunnar: „Dann fang ich an und Du kannst Dir dann Deine eigene Botschaft ausdenken. 😊 Meine Botschaft wäre ganz kurz und knapp: Gemeinsam Wasser genießen und schützen!“
„Ui, das ist ein toller Slogan! Der gefällt mir supergut!“
Gunnar: „Ich hätte zwei Botschaften: Eine an die Leserinnen und Leser und eine an die Politik. Der breiten Öffentlichkeit möchte ich gerne folgendes sagen, und damit nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs gehen, zum Thema Sport. In Deutschland kann man überall Wasser zapfen. Habt immer eine Flasche zum Befüllen dabei, dann seht Ihr, wie einfach das ist – und wie schützenswert unser Wasser ist!
Und meine politische Botschaft ist: Wasser muss in seiner Gesamtheit gedacht und über alle Ressorts hinweg behandelt werden. Das muss die Politik hinbekommen. Wasser ist nichts zum Profilieren, das ist ein für alle zentrales und wichtiges Gut. Wir müssen uns gemeinsam darum kümmern, da sollte es keine getrennten Ressorts geben.“
Anne: „Dazu fällt mir auch noch was ein: Ich habe eine Zeit lang in England gearbeitet und die Regierung von Wales hat zu der Zeit ein Gesetz verabschiedet, dass alle zukünftigen Gesetze und Verordnungen auf Klimaschutz basieren müssen. Sowas könnte man hier bei uns auch fürs Wasser machen.“
„Das sind doch tolle Schlussworte und richtig viele wertvolle Informationen für unsere Community, die ja aus „Wasserern“ und aus der breiten Öffentlichkeit besteht. Tausend Dank für die tolle Stunde mit Euch und viele Grüße nach München!“
Gunnar und Anne: „Danke an das WIT und viele Grüße zurück!“